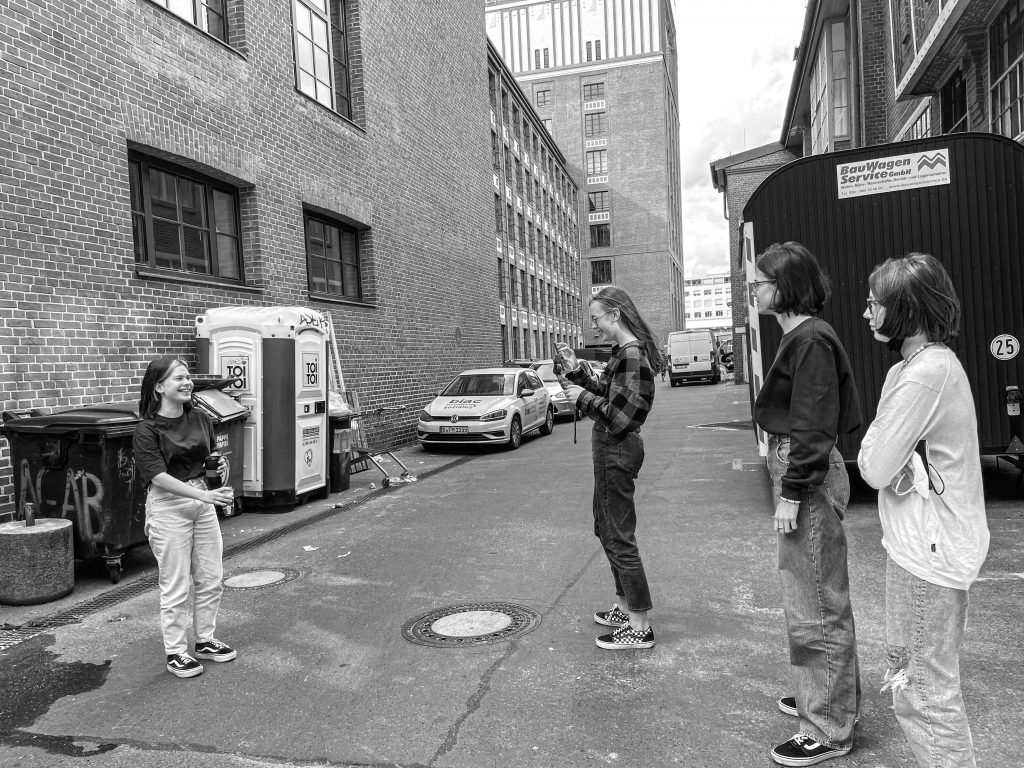Eine kleine Buchhandlung von neben an I DIGGA Podcast
Ich bin Helene und Schülerpraktikantin bei ALEX Berlin und ich habe eine Buchhändlerin aus der Buchhandlung Behm Havelländische Buchhandelsgesellschaft interviewt, über ihren Laden welcher in Hohen Neuendorf zu finden ist. Das Gespräch habe ich mit Frau Schochow durchgeführt welche für die Leitung des Ladens zuständig ist und selbst eine begeisterte Leserin ist. In dem Interview …
Eine kleine Buchhandlung von neben an I DIGGA Podcast Weiterlesen »